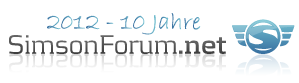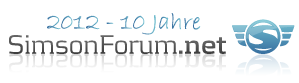Moinsen ...
Ich wollt fragen ob jemand schon son Vortrag gemacht hat !? Ich muss den in Ethik halten eben über seine Philosophische Richtung ...
MfG
Moinsen ...
Ich wollt fragen ob jemand schon son Vortrag gemacht hat !? Ich muss den in Ethik halten eben über seine Philosophische Richtung ...
MfG
lebenslauf ...
Schopenhauer, Arthur (1788-1860), deutscher Philosoph. Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 als Sohn eines angesehenen Kaufmanns und der später als Schriftstellerin bekannt gewordenen Johanna Schopenhauer in Danzig (heute Gdansk, Polen) geboren. Nach dem Willen des Vaters ursprünglich zum Kaufmann bestimmt, begann er 1809 an der Universität Göttingen ein Studium der Medizin, das er jedoch bald aufgab, um sich der Philosophie zuzuwenden. 1811 ging er nach Berlin, wo er Schüler von Friedrich Schleiermacher und Johann Gottlieb Fichte wurde. In Jena promovierte er 1813 mit der Abhandlung Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 1816 veröffentlichte er in Konkurrenz zu Goethe eine Farbenlehre mit dem Titel Über das Sehen und die Farben, das bereits die grundlegenden erkenntnistheoretischen Positionen des späteren Werks widerspiegelt. Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung erschien im Jahr 1819. In der Folgezeit unternahm er eine Italienreise. Von 1820 bis 1831 war er ebenso wie G. W. F. Hegel, jedoch mit weit geringerer Resonanz, an der Universität Berlin als Dozent tätig. Nach Ausbruch einer Choleraepidemie, der Hegel zum Opfer fiel, ließ Schopenhauer sich in Frankfurt am Main nieder, wo er, durch eine Erbschaft finanziell abgesichert, bis zu seinem Tod zurückgezogen als Privatgelehrter lebte. Hier widmete er sich der Abfassung seiner Schriften und u. a. dem Studium der buddhistischen und hinduistischen Philosophie und der Mystik, wobei er besonders durch die Mystiker Meister Eckhart und Jakob Böhme beeinflusst wurde. In dieser Zeit erschienen folgende Schriften: Über den Willen in der Natur (1836), Die beiden Grundprobleme der Ethik (1841), die erweiterte und überarbeitete Fassung seines Hauptwerks, Die Welt als Wille und Vorstellung II (1844), das zweibändige, aphoristische Werk Parerga und Paralipomena (1851), darin enthalten Die Aphorismen zur Lebensweisheit. Arthur Schopenhauer starb am 21. September 1860 in Frankfurt am Main.
Unter dem Einfluss Platons und Immanuel Kants vertritt Schopenhauer in seiner Erkenntnistheorie die Position des Idealismus. Er beschreitet jedoch innerhalb dieser Grundauffassung einen eigenen Weg und lehnt die Philosophie Hegels ab. Durch das Aufgreifen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit ist Schopenhauer in der Lage, eine Physiologie der Wahrnehmung zu entwickeln. Nach seiner Konzeption existiert die Erscheinungswelt nur insoweit, als sie wahrgenommen wird und im menschlichen Bewusstsein ist, also als Vorstellung. Er stimmt jedoch nicht mit Kant darin überein, dass das Ding an sich jenseits aller Erfahrung liegt und deshalb nicht erkannt werden kann. Nach Schopenhauer liegt der Vorstellungswelt der Wille zu Grunde, den er als grundlosen und ziellosen (blinden) Drang versteht. Im Gegensatz zur Philosophie Hegels spricht er damit der Welt und der Geschichte jeglichen Sinn ab. Dem Willen liegt nicht nur das Handeln des Menschen zugrunde, sondern er umfasst die gesamte Wirklichkeit, das heißt die organische (tierische und pflanzliche) und die unorganische Natur. Er objektiviert sich in der Erscheinungswelt als Wille zum Leben und zur Fortpflanzung. Diese Lehre vom „Primat des Willens†bildet die zentrale Idee der Schopenhauer’schen Philosophie, sie hatte weit reichenden Einfluss und begründet die Aktualität von Schopenhauers Werk.
Der Wille ist ein nicht zu befriedigender Daseinsdrang, aus dem das Leiden des Menschen erwächst, denn der Wille erzeugt ständig neue Bedürfnisse, die letztendlich nicht befriedigt werden können. Höchster Ausdruck des Willens ist der Geschlechtstrieb. Da es aufgrund der nicht zu befriedigenden Wünsche kein dauerhaftes Glück gibt, ist das Leben unausweichlich von Schmerz und Leiden gekennzeichnet. Auf dieser Einsicht basiert Schopenhauers pessimistische Grundhaltung. Auf einer höheren Stufe kann der Mensch jedoch dem Diktat des Willens entrinnen und ist dadurch fähig, sich selbst zu erlösen. Die Erlösung vom Leiden geschieht durch die Verneinung des Willens, die der Mensch entweder durch Kontemplation in der Kunstbetrachtung oder durch Askese und Entsagung gewinnt, durch die sämtliche Bedürfnisse zum Schweigen gebracht werden. In der Kunstbetrachtung löst sich der Mensch vom Willen und wird „reines, willenloses Subjekt der Erkenntnisâ€. Nach Schopenhauers Ästhetik wirkt die Kunst als „Quietiv des Willensâ€.
Während der Mensch in der Kunstbetrachtung nur vorübergehend die Fesseln des Willens ablegt, zeigt Schopenhauers Ethik den Weg zur endgültigen Negation des Willens. Schopenhauer fundiert seine Ethik im Gegensatz zu Kant nicht in der Vernunft und im Sittengesetz, sondern er sieht das Mitleid als die Basis des moralischen Handelns. Durch das Mitleid wird der Egoismus überwunden, der Mensch identifiziert sich mit dem anderen durch die Einsicht in das Leiden der Welt. Schopenhauers Metaphysik ist stark vom Buddhismus geprägt, und in seiner Ethik verbindet er buddhistische Anschauungen mit denen der christlichen Mystik.
Bei seinem Erscheinen wurde Schopenhauers Werk kaum beachtet, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann es seine weit reichende Wirkung zu entfalten. Im Bereich der Philosophie beeinflusste er besonders Friedrich Nietzsche und die Lebensphilosophie Henri Bergsons, in der Musik u. a. Richard Wagner, in der Literatur Thomas Mann. Schopenhauers Lehre vom Primat des Willens hatte tief greifenden Einfluss. In der Psychologie wurden seine Gedanken u. a. von Eduard von Hartmann und Sigmund Freud aufgenommen. Denn hier ist ein Kerngedanke der Psychoanalyse vorgeprägt, der ein grundlegend anderes Menschenbild hervorbringt: Die Ratio des Menschen ist nur ein Oberflächenphänomen, während das Handeln weitgehend durch verborgene Triebregungen gelenkt wird.
sein hauptwerk über den willen der blind alles lenkt
Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819)
Wir haben längst dieses den Kern und das Ansich jedes Dinges ausmachende Streben als das selbe und nämliche erkannt, was in uns, wo es sich am deutlichsten, am Lichte des vollesten Bewußtseyns manifestirt, W i l l e heißt. Wir nennen dann seine Hemmung durch ein Hindernis, welches sich zwischen ihn und sein einstweiliges Ziel stellt, L e i d e n; hingegen sein Erreichen des Ziels B e f r i e d i g u n g, Wohlseyn, Glück. Wir können diese Benennungen auch auf jene, dem Grade nach schwächern, dem Wesen nach identischen Erscheinungen der erkenntnißlosen Welt übertragen. Diese sehn wir alsdann in stetem Leiden begriffen und ohne bleibendes Glück. Denn alles Streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, so lange es nicht befriedigt ist; keine Befriedigung aber ist dauernd, vielmehr ist sie stets nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens. Das Streben sehn wir überall vielfach gehemmt, überall kämpfend; so lange also immer als Leiden: kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maaß und Ziel des Leidens.
Was wir aber so nur mit geschärfter Aufmerksamkeit und mit Anstrengung in der erkenntnißlosen Natur entdecken, tritt uns deutlich entgegen in der erkennenden, im Leben der Thierheit, dessen stetes Leiden leicht nachzuweisen ist. Wir wollen aber, ohne auf dieser Zwischenstufe zu verweilen, uns dahin wenden, wo, von der hellsten Erkenntniß beleuchtet, Alles aufs deutlichste hervortritt, im Leben des Menschen. Denn wie die Erscheinung des Willens vollkommener wird, so wird auch das Leiden mehr und mehr offenbar. In der Pflanze ist noch keine Sensibilität, also kein Schmerz: ein gewiß sehr geringer Grad von Beiden wohnt den untersten Thieren, den Infusorien und Radiarien ein: sogar in den Insekten ist die Fähigkeit zu empfinden und zu leiden noch beschränkt: erst mit dem vollkommenen Nervensystem der Wirbelthiere tritt sie in hohem Grade ein, und in immer höherem, je mehr die Intelligenz sich entwickelt. In gleichem Maaße also, wie die Erkenntniß zur Deutlichkeit gelangt, das Bewußtseyn sich steigert, wächst auch die Quaal, welche folglich ihren höchsten Grad im Menschen erreicht, und dort wieder um so mehr, je deutlicher erkennend, je intelligenter der Mensch ist: der, in welchem der Genius lebt, leidet am meisten. In diesem Sinne, nämlich in Beziehung auf den Grad der Erkenntniß überhaupt, nicht auf das bloße abstrakte Wissen, verstehe und gebrauche ich hier jenen Spruch des Koheleth [Predigers Salomo]: Qui auget scientiam, auget et dolorem [Wer das Wissen vermehrt, vermehrt zugleich den Schmerz: 1,18]. – Dieses genaue Verhältniß zwischen dem Grade des Bewußtseyns und dem des Leidens hat durch eine anschauliche und augenfällige Darstellung überaus schön in einer Zeichnung ausgedrückt jener philosophische Maler, oder malende Philosoph, T i s c h b e i n. Die obere Hälfte seines Blattes stellt Weiber dar, denen ihre Kinder entführt werden, und die, in verschiedenen Gruppen und Stellungen, den tiefen mütterlichen Schmerz, Angst, Verzweiflung, mannigfaltig ausdrücken; die untere Hälfte des Blattes zeigt, in ganz gleicher Anordnung und Gruppirung, Schaafe, denen die Lämmer weggenommen werden: so daß jedem menschlichen Kopf, jeder menschlichen Stellung der obern Blatthälfte, da unten ein thierisches Analogon entspricht und man nun deutlich sieht, wie sich der im dumpfen thierischen Bewußtseyn mögliche Schmerz verhält zu der gewaltigen Quaal, welche erst durch die Deutlichkeit der Erkenntniß, die Klarheit des Bewußtseyns, möglich ward.
Wir wollen dieserwegen im m e n s c h l i c h e n D a s e y n das innere und wesentliche Schicksal des Willens betrachten. Jeder wird leicht im Leben des Thieres das Nämliche, nur schwächer, in verschiedenen Graden ausgedrückt wiederfinden und zur Genüge auch an der leidenden Thierheit sich überzeugen können, wie wesentlich a l l e s L e b e n L e i d e n ist.
§ 57.
Auf jeder Stufe, welche die Erkenntniß beleuchtet, erscheint sich der Wille als Individuum. Im unendlichen Raum und unendlicher Zeit findet das menschliche Individuum sich als endliche, folglich als eine gegen Jene verschwindende Größe, in sie hineingeworfen und hat, wegen ihrer Unbegränztheit, immer nur ein relatives, nie ein absolutes W a n n und W o seines Daseyns: denn sein Ort und seine Dauer sind endliche Theile eines Unendlichen und Gränzenlosen. – Sein eigentliches Daseyn ist nur in der Gegenwart, deren ungehemmte Flucht in die Vergangenheit ein steter Uebergang in den Tod, ein stetes Sterben ist; da sein vergangenes Leben, abgesehn von dessen etwanigen Folgen für die Gegenwart, wie auch von dem Zeugniß über seinen Willen, das darin abgedrückt ist, schon völlig abgethan, gestorben und nichts mehr ist: daher auch es ihm vernünftigerweise gleichgültig seyn muß, ob der Inhalt jener Vergangenheit Quaalen oder Genüsse waren. Die Gegenwart aber wird beständig unter seinen Händen zur Vergangenheit: die Zukunft ist ganz ungewiß und immer kurz. So ist sein Daseyn, schon von der formellen Seite allein betrachtet, ein stetes Hinstürzen der Gegenwart in die todte Vergangenheit, ein stetes Sterben. Sehn wir es nun aber auch von der physischen Seite an; so ist offenbar, daß wie bekanntlich unser Gehn nur ein stets gehemmtes Fallen ist, das Leben unsers Leibes nur ein fortdauernd gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tod ist: endlich ist eben so die Regsamkeit unsers Geistes eine fortdauernd zurückgeschobene Langeweile. Jeder Athemzug wehrt den beständig eindringenden Tod ab, mit welchem wir auf diese Weise in jeder Sekunde kämpfen, und dann wieder, in größern Zwischenräumen, durch jede Mahlzeit, jeden Schlaf, jede Erwärmung u. s. w. Zuletzt muß er siegen: denn ihm sind wir schon durch die Geburt anheimgefallen, und er spielt nur eine Weile mit seiner Beute, bevor er sie verschlingt. Wir setzen indessen unser Leben mit großem Antheil und vieler Sorgfalt fort, so lange als möglich, wie man eine Seifenblase so lange und so groß als möglich aufbläst, wiewohl mit der festen Gewißheit, daß sie platzen wird.
Sahen wir schon in der erkenntnißlosen Natur das innere Wesen derselben als ein beständiges Streben, ohne Ziel und ohne Rast; so tritt uns bei der Betrachtung des Thieres und des Menschen dieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Streben ist sein ganzes Wesen, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu vergleichen. Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz, dem er folglich schon ursprünglich und durch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn furchtbare Leere und Langeweile: d. h. sein Wesen und sein Daseyn selbst wird ihm zur unerträglichen Last. Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile, welche Beide in der That dessen letzte Bestandtheile sind. Dieses hat sich sehr seltsam auch dadurch aussprechen müssen, daß, nachdem der Mensch alle Leiden und Quaalen in die Hölle versetzt hatte, für den Himmel nun nichts übrig blieb, als eben Langeweile.
Das stete Streben aber, welches das Wesen jeder Erscheinung des Willens ausmacht, erhält auf den höhern Stufen der Objektivation seine erste und allgemeinste Grundlage dadurch, daß hier der Wille sich erscheint als ein lebendiger Leib, mit dem eisernen Gebot, ihn zu nähren: und was diesem Gebote die Kraft giebt, ist eben, daß dieser Leib nichts Anderes, als der objektivirte Wille zum Leben selbst ist. Der Mensch, als die vollkommenste Objektivation jenes Willens, ist demgemäß auch das bedürftigste unter allen Wesen: er ist konkretes Wollen und Bedürfen durch und durch, ist ein Konkrement [Gebilde] von tausend Bedürfnissen. Mit diesen steht er auf der Erde, sich selber überlassen, über Alles in Ungewißheit, nur nicht über seine Bedürftigkeit und seine Noth: demgemäß füllt die Sorge für die Erhaltung jenes Daseyns, unter so schweren, sich jeden Tag von Neuem meldenden Forderungen, in der Regel, das ganze Menschenleben aus. An sie knüpft sich sodann unmittelbar die zweite Anforderung, die der Fortpflanzung des Geschlechts. Zugleich bedrohen ihn von allen Seiten die verschiedenartigsten Gefahren, denen zu entgehn es beständiger Wachsamkeit bedarf. Mit behutsamem Schritt und ängstlichem Umherspähen verfolgt er seinen Weg: denn tausend Zufälle und tausend Feinde lauern ihm auf. So gieng er in der Wildniß, und so geht er im civilisirten Leben; es giebt für ihn keine Sicherheit:
Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis
Degitur hocc’ aevi, quodcunque est!
[Ach, in welchem Dunkel des Seins, in wie großen Gefahren,
Wird dies Leben verbracht, solange es dauert!]
Lucr[etius, De rerum natura], II. 15.
Das Leben der Allermeisten ist auch nur ein steter Kampf um diese Existenz selbst, mit der Gewißheit ihn zuletzt zu verlieren. Was sie aber in diesem so mühsäligen Kampfe ausdauern läßt, ist nicht sowohl die Liebe zum Leben, als die Furcht vor dem Tode, der jedoch als unausweichbar im Hintergrunde steht und jeden Augenblick herantreten kann. – Das Leben selbst ist ein Meer voller Klippen und Strudel, die der Mensch mit der größten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeidet, obwohl er weiß, daß, wenn es ihm auch gelingt, mit aller Anstrengung und Kunst sich durchzuwinden, er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unvermeidlichen und unheilbaren Schiffbruch näher kommt, ja gerade auf ihn zusteuert, – dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der mühsäligen Fahrt und für ihn schlimmer als alle Klippen, denen er auswich.
Microsoft® Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 © 1993-2002 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Danke ![]() Super !! Echt geil !!
Super !! Echt geil !!
Thx !!!
im groben und ganzen war er einmisantroph der vor allem die aufklärer hasste duie alles allzu optimistisch sahen ....
er fühlte seine theorie des blinden willens der natur mit seiner unbändigen kraft bestätigt als es in lissabon ein schweres erdbeben gab und alle aufklärer sich wunderten über die sinnlose zerstöreng die die natur anrichtete und das nicht alles im einklang ist ....
copyright by philosophie unterricht 12/1 kurze zusammenfassung über schopenhauer ...
also nach kant zb gibt es das ding an sich was aús empiristischer welt und em unbekannten besteht .... für schopenhauer ist das " ding an sich " der wille ..... hoffe das hilft dir
Jo Danke !!! damit krieg ich schon nen ordentlichen Vortrag hin Thx !
und wie watr der vortrag ? ![]()
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!